Künstliche Intelligenz im Sportjournalismus
„Der Sportjournalismus lebt von Emotionen und kreativen Ansätzen, daher kann KI ihn nicht ersetzen“
Herr Bertling, wie viel Künstliche Intelligenz gibt es im Sportjournalismus?
Ich habe mich kürzlich mit einem Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga unterhalten, die die Kamerasysteme für die Bildübertragung zusammensetzt. Seine Antwort: Ja, wir können die Kamerasysteme komplett automatisiert herstellen, ohne Personal. Aber das wäre so eine starke Standardisierung, dass es als Produkt nicht mehr funktionieren würde. Mein Problem mit KI ist die Bezeichnung an sich. Wenn wir Künstliche Intelligenz als Wort einmal beiseite nehmen, dann sprechen wir eigentlich von einer Vollautomatisierung in der Produktion, und die ist tatsächlich da. Sie ist aber nicht wahnsinnig intelligent.
Haben Sie ein Beispiel, wo vollautomatisierte Berichterstattung bereits zum Einsatz kommt oder gekommen ist?
Amazon hat 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio erstmals seinen Schreibroboter Heliograf umfänglich eingesetzt. Die Software verfasste Sportbeiträge in beliebig vielen lokalen und regionalen Varianten. Der Heliograf hat dafür gesorgt, dass es eine vollautomatisierte Berichterstattung vom Venue direkt in die Agenturen gab. Und die Agenturen haben die Inhalte direkt auf ihre Medienseiten gesetzt. Hier merken wir, dass eine Vollautomatisierung absolut Sinn macht, da Spielberichte relativ einfach und schnell zu schreiben und über Algorithmen zu setzen sind. Aber das ist ja nicht das, was wir im Sport wollen. Wir wollen gewisse Emotionen, und diese Möglichkeiten der kreativen Ansätze kann KI, wie sie momentan aufgestellt ist, noch nicht.
Würden wir Rezipient*innen es denn überhaupt merken, wenn ein Medienbeitrag von einer Maschine kommt?
Jüngste Studien zeigen, dass es eigentlich nicht mehr zu unterscheiden ist. Das hat auch damit zu tun, dass wir im Sport immer mehr standardisierte Sportprodukte haben. Und je standardisierter Produkte sind, desto besser können sie in Algorithmen übertragen werden. Würden wir einem Sportrezipienten ein automatisiertes Bundesliga-Signal zeigen, würde der Turing-Test funktionieren. Alan Turing ist einer der Pioniere der KI, der 1950 festgehalten hat: KI ist es dann, wenn der Allgemeine nicht erkennen kann, ob es eine Maschine- oder eine Mensch-Kommunikation ist.
Ist das nicht ein bisschen spooky?
Irgendwie auch nicht. Viele Bereiche im Sport sind halt einfach standardisiert, wie zum Beispiel das Erstellen einer Tabelle. Spooky wird es dann, wenn wir unter KI verstehen, dass Roboter mit uns kommunizieren. Das ist auch die größte Angst in den Redaktionen, wie Untersuchungen von uns gezeigt haben. Aber dass der Journalismus durch KI ersetzt wird, das glaube ich nicht. KI ist da, sie kann viel, sie kann auch nicht mehr rückgängig gemacht werden und ist auch nicht mehr aufzuhalten. Es ist absolut vorstellbar, dass die FIFA ohne einen Regisseur und ohne einen Kameramann, also rein technisch, Bilder produziert. Sie könnte es genauso umstellen. Sie tut es aber nicht. Ich denke, dass Sportjournalismus immer ein Produkt sein wird, das von Menschen erstellt ist, weil die Menschen es so wollen. Sie wollen kein rein maschinelles Kalkül. Wichtig ist, dass KI kontrolliert wird – auch durch die Wissenschaft.
Beim Thema KI sprechen wir nicht nur über die Gestaltung der Sportinhalte, sondern auch darüber, wie KI die Zuschauer*innen beeinflusst. Kann KI jetzt schon steuern, was sich User*innen in den Medien anschauen?
Relativ einfach sogar. Wir suchen uns in der Mediennutzung, meist unbewusst, die Formate aus, die zu unserer Meinung bereits passen. Wir bewegen uns in sogenannten Filterblasen. Einstellungen werden nicht verändert, sondern verstärkt. Das machen sich die Sozialen Medien zunutze. Algorithmen spielen gezielt nur noch die Inhalte aus, die wir uns sowieso schon gerne ansehen. Der Prozess der Selektion wird also nicht mehr nur vom Menschen selbst beeinflusst, sondern auch durch KI. Das Interesse der Unternehmen dabei ist natürlich, viele Zugriffe und Klicks zu generieren.
Dr. Christoph Bertling (Jahrgang 1974, geboren in Würzburg) ist Diplom-Sportwissenschaftler und Studienrat im Hochschuldienst. Er studierte Sportwissenschaften und Kommunikationswissenschaft an der Deutschen Sporthochschule Köln und an der State University of New York in Cortland. Danach war er selbstständiger Journalist und Korrespondent u. a. für die Süddeutsche Zeitung, FAZ, Financial Times, Frankfurter Rundschau, Kölner Stadt-Anzeiger, Spiegel Online, Deutsche Welle (Live-Radiomoderator). Im PR-Bereich hat er für die Lufthansa, den Vfl Gummersbach sowie das AOK-Managermagazin gearbeitet. Seit 2003 ist er Mitarbeiter am Institut für Kommunikations- und Medienforschung an der Deutschen Sporthochschule Köln. Er ist ehrenamtliches Mitglied der Medienkommission beim DOSB und gibt Kommunikationstraining und -beratung für zahlreiche Vereine und Verbände. Er ist Preisträger des Health Media Award in der Kategorie Wissenschaftskommunikation und mehrfacher Preisträger des Lehrpreises der Deutschen Sporthochschule Köln.
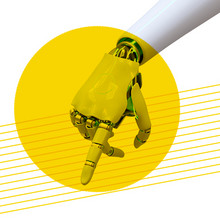

Kontakt

Christoph Bertling
| Telefon | +49 221 4982-6080 |
|---|---|
| bertling@dshs-koeln.de | |
| Website | Forschungsprofil |